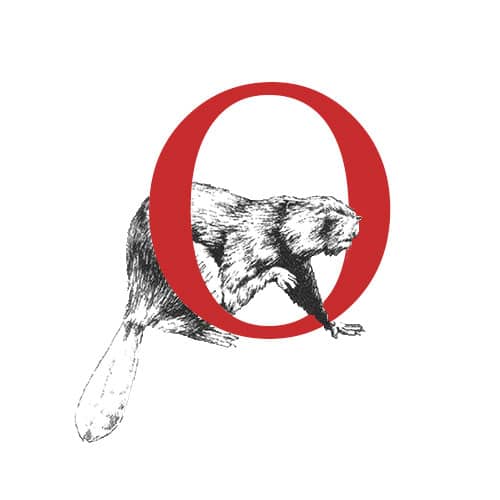Presseerklärung Nr. 1
zum Thema Unternehmensflurneuordnung:
Der Leiter der Nationalparkverwaltung erzählt den Landwirten, dass zum 1.1.2026 der Flurbereinigungsplan in Kraft gesetzt wird und infolgedessen die Landwirte, die bisher die sogenannten Zone Ib-Flächen bewirtschaftet hätten, diese dann ab dem 1.1.2026 als sogenannte Zone Ia-Flächen nicht mehr bewirtschaften dürften und auch dafür keine Subventionen im Rahmen der Agrarförderung mehr erhalten werden.
Diese Aussage ist nur zum Teil richtig, sie gilt für Landesflächen. Für Flächen des Vereins der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e. V. (Nationalparkverein) trifft diese Aussage hingegen voraussichtlich nicht zu, denn der Nationalparkverein hat, wie andere Landbesitzer auch, frist- und formgerecht gegen den Flurbereinigungsplan Widerspruch eingelegt, vielmehr drei Widersprüche, jeweils einen für das Verfahrensteilgebiet Nord, Süd I und Süd II. Diese Widersprüche sind auch mehrere Jahre nach Abgabe immer noch nicht beschieden. Es ist auch im laufenden Jahr nicht mehr damit zu rechnen. Für alle Grundeigentümer, wie den Nationalparkverein, aber auch andere private Grundeigentümer, die Widerspruch eingelegt haben, tritt der Flurbereinigungsplan zum 1.1.2026 also nicht in Kraft. Erst muss die Spruchstelle den Widersprüchen abhelfen oder ihn ablehnen, womit zu rechnen ist, denn die Spruchstelle ist beim brandenburgischen Landwirtschaftsministerium angesiedelt, also nicht unabhängig. Erst dann kann der Grundeigentümer, in diesem Falle der Nationalparkverein, dagegen Rechtsmittel einlegen. Bis zum Abschluss des Rechtsweges ist es also noch eine Weile hin, mindestens zwei Instanzen. So lange können die Landwirte, die Vereinsflächen gepachtet haben, also auch Zone Ib-Flächen, diese weiter bewirtschaften und auch Subventionen, beispielsweise KULAP-Mittel erhalten.
Pächter von Zone Ib-Flächen des Landes hingegen dürfen und können das voraussichtlich nicht. Ihre Flächen vom Lande Brandenburg als Zone Ia-Flächen, also als Totalreservate ausgewiesen und fallen damit aus der Nutzung und Förderung heraus. Allzu viele Hektar und Landwirte dürften davon eigentlich nicht betroffen sein, denn im Rahmen der Flurneuordnung hat die Flurneuordnungsbehörde auf Weisung des Landwirtschaftsministeriums die Ia- und Ib-Flächen ganz überwiegend dem Nationalparkverein zugewiesen und dem Land Brandenburg ganz überwiegend Zone II-Flächen, die also dauerhaft in Nutzung und Förderung bleiben. Dadurch sollte der missliebige und unbotmäßige Nationalparkverein so weit wie möglich wirtschaftlich geschwächt oder gar ausgeschaltet werden. Diese Rechnung geht in einem Rechtsstaat aber nicht auf. Da herrschen Gesetze wie das Flurbereinigungsgesetz, da entscheiden letztendlich unabhängige Richter. Behördlicher Willkür sind damit Grenzen gesetzt.
Der Nationalparkverein ist an einem langen, teuren Rechtsstreit nicht interessiert und hat dem Land Brandenburg mehrfach Kompromisslösungen angeboten, die vom Landwirtschaftsministerium aber allesamt abgelehnt wurden. Insofern läuft es im Moment also auf einen Rechtsstreit hinaus. Der Vorwurf des Leiters der Nationalparkverwaltung, der Nationalparkverein verzögere oder verhindere mit diesem Verhalten die Entwicklung des Nationalparks, geht ins Leere:
Die Frage, wieviel Prozent des einzigen Nationalparks Brandenburgs Totalreservate sind, ist eher zweitrangig. Die wirklichen Probleme des Nationalparks liegen aktuell in den auf polnischer Seite bereits durchgeführten, auf deutscher Seite geplanten Oder-Ausbaumaßnahmen, in der Vergiftung des Flusses durch Salze, Chemikalien und Nährstoffe aus dem oberschlesischen Industrierevier (Polen) und bei den auf deutscher Seite durchgeführten, sündhaft teuren und sinnlosen Einzäunungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweine-pest (ASP). Der Nationalpark ist mittlerweile eingezäunt wie ein großer Zoo, nur ohne Elefanten.
Auch mit den von der Nationalparkverwaltung angestrebten 50 Prozent Totalreservaten erreicht der Nationalpark Unteres Odertal immer noch bei weitem nicht den begehrten, offiziellen Nationalparkstatus der Weltnaturschutzorganisation (IUCN), die mittlerweile 75 Prozent Totalreservate für einen echten Nationalpark fordert. Das ist im unteren Odertal bisher jedenfalls nicht geplant. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist es kein Nachteil, wenn einige Großsäuger grasend durch die Aue ziehen, wie es schon früher, lange vor dem Auftreten des Menschen, Wisente, Auerochsen, Tarpane, Elche und Rothirsche in großer Zahl taten und damit die Landschaft offenhielten. Der Nationalparkverein hat also gegen eine extensive Beweidung (0,3 Großvieheinheiten/Hektar) auf der ganzen Fläche keine Einwendungen. Sie dient sogar, wie zahlreiche Untersuchungen zeigen, der Artenvielfalt.
Viel wichtiger für einen Auennationalpark sind natürliche Wasserverhältnisse, also ein ungehinderter Zu- und Abfluss des Oderwassers in die Polder, entsprechend dem Wasserstand der Oder. Das ist im pol-nischen Teil des Internationalparks, dem Zwischenoderland, das nun endlich, zumindest teilweise, auch zum Nationalpark erklärt werden soll, ja seit Kriegsende schon der Fall.
30 Jahre lang, seit der Nationalparkgründung, hat die Nationalparkverwaltung jedes Jahr, wie vom Polizeipräsidenten in Stettin (Szczecin) 1931 seinerzeit festgelegt worden war, die Ein- und Auslassbau-werke geschlossen und das Wasser aus dem Nationalpark abgepumpt und ausgesperrt. Erst seit wenigen Jahren hat die Nationalparkverwaltung den Termin vier Wochen nach hinten verschoben, durchaus auch mit Zustimmung der Landwirte, da immer weniger Wasser die Oder hinunterfließt. Das ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung. Er kommt spät, aber immerhin.
Es kommt also auf die richtige Reihenfolge an. Erst braucht man in einem Auennationalpark natürliche Wasserverhältnisse und dann macht es Sinn, Totalreservate auszuweisen. Geht man andersherum vor, wuchern nur Brennnesseln und Seggen. Der Nationalparkverein möchte den Landwirten nicht ihre Einkommensquellen nehmen. Er erwartet aber von seinen Pächtern im Nationalpark, dass sie in Zukunft deutlich weniger mähen und häufiger, vor allem sehr extensiv, beweiden. So kommen wir den natürlichen Verhältnissen, die wir zum Schutze der Pflanzen und Tiere wiederherstellen möchten, am nächsten. Wenn natürliche Wasserverhältnisse im unteren Odertal gegeben sind, mag das Landwirtschaftsministerium 50 Prozent als Totalreservat ausweisen, das ist das Primat der Politik, das akzeptieren wir natürlich. Aber man soll das Pferd nicht von hinten aufzäumen.
Wenn das Landwirtschaftsministerium aber sofort die Zone Ib Flächen in Zone Ia Flächen (Totalreservate) umwandeln will, so steht ihm das natürlich frei, der Weg dorthin geht einfach und schnell: Es braucht nur einen rechtskonformen Flurbereitungsplan in Kraft zu setzen, sprich sich selbst die Zone Ia und Ib Flächen und dem Verein die Zone II Flächen zuzuordnen und die mit Fördermitteln vom Nationalparkverein gekauften, außerhalb des Nationalparks gelegenen Austauschflächen in den Nationalpark einzutauschen, dann haben sich die Widersprüche des Nationalparkvereins im Wesentlichen erledigt. So einfach ist das!
Der Vereinsvorstand